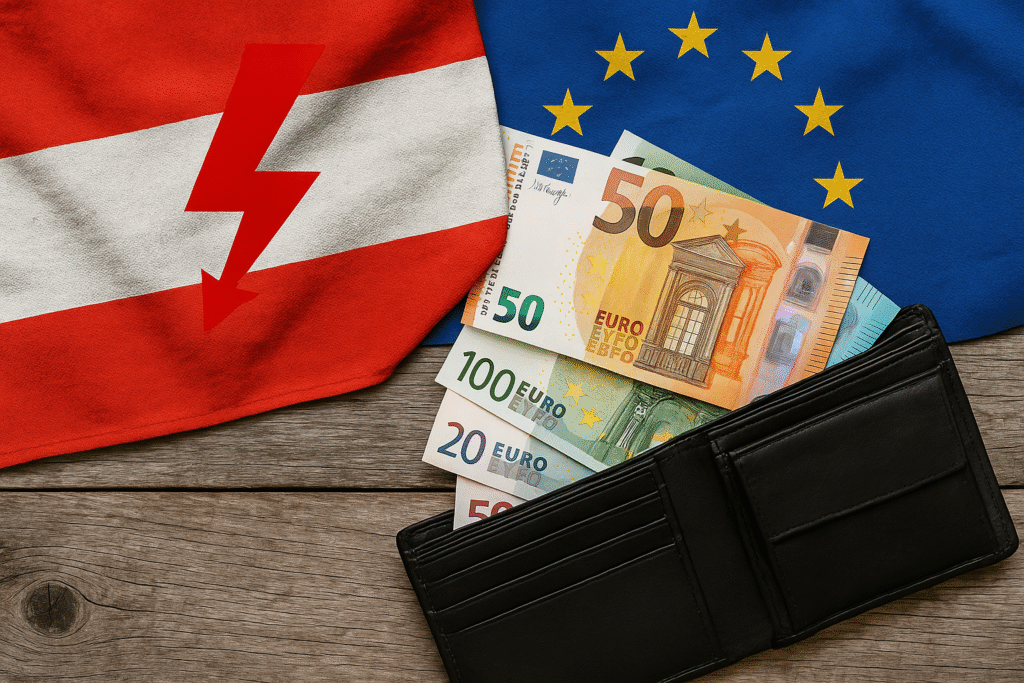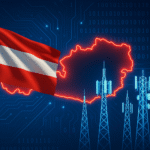Der Kampf um faire Preise: Einleitung in ein brisantes Thema
Der aktuelle Diskurs um den sogenannten „Österreich-Preisaufschlag“ hat neue Dimensionen erreicht. Seit Jahren kämpfen der Handelsverband und die Gewerkschaft GPA für ein freies und faires Warenangebot im europäischen Binnenmarkt. Doch was verbirgt sich hinter den territorialen Lieferbeschränkungen, die die Preise in Österreich in die Höhe treiben?
Was sind territoriale Lieferbeschränkungen?
Territoriale Lieferbeschränkungen, auch als Territorial Supply Constraints (TSCs) bekannt, sind von großen Herstellern auferlegte Beschränkungen. Sie verhindern, dass Einzelhändler Produkte in einem Mitgliedsstaat kaufen und in einem anderen weiterverkaufen. Diese Praxis erlaubt es internationalen Produzenten, Produkte in unterschiedlichen Märkten zu unterschiedlichen Preisen anzubieten.
Ein praktisches Beispiel: Ein österreichischer Händler möchte den Haarspray eines multinationalen Produzenten einkaufen. Dafür muss er über die nationale Vertriebsgesellschaft des jeweiligen Multis gehen. Während der Haarspray für den österreichischen Händler 3,20 Euro in der Beschaffung kostet, zahlt ein deutscher Händler nur 2 Euro. Diese Preisunterschiede betreffen nicht nur Österreich, sondern auch andere kleinere Länder wie Dänemark, Belgien oder Luxemburg.
Historische Hintergründe: Die Entstehung der Binnenmarktstrategie
Die Idee eines freien Binnenmarktes innerhalb der EU besteht seit der Gründung der Europäischen Gemeinschaft. Ziel war es, Handelshemmnisse abzubauen und den freien Warenverkehr zu fördern. In der Praxis jedoch segmentieren multinationale Konzerne den Markt entlang nationaler Grenzen, was den internationalen Einkauf erschwert.
Im Mai 2025 schien ein Durchbruch nahe. Eine geleakte Version der neuen EU-Binnenmarktstrategie versprach ein Verbot dieser Praktiken. Doch in der finalen Version war nur noch von „Instrumenten zur Bekämpfung ungerechtfertigter territorialer Lieferbeschränkungen“ die Rede.
Die Auswirkungen auf den österreichischen Verbraucher
Die Folgen dieser Praktiken sind für österreichische Verbraucher gravierend. Produkte des täglichen Bedarfs, wie Lebensmittel, Kosmetik oder Reinigungsmittel, sind hierzulande deutlich teurer als in Deutschland. Laut der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) gibt es einen „Österreich-Aufschlag“ von mindestens 15 bis 20% im Vergleich zu deutschen Preisen.
Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes, erklärt: „Unsere österreichischen Händler müssen in der Beschaffung je nach Produkt um bis zu 60 Prozent höhere Preise bezahlen als deutsche Händler. Dieser Österreich-Preisaufschlag ist ein reines Körberlgeld der multinationalen Markenartikelindustrie.“
Vergleich mit anderen EU-Ländern
Österreich ist nicht allein in dieser Situation. Auch andere kleinere EU-Länder wie Dänemark, Belgien oder Luxemburg sind von ähnlichen Preisaufschlägen betroffen. In großen Märkten wie Deutschland oder Frankreich hingegen sind die Preise aufgrund der Marktgröße und des Wettbewerbs signifikant niedriger.
Der Ruf nach Veränderung: Experten und ihre Einschätzungen
Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA, fordert eine rasche Umsetzung der EU-Binnenmarktstrategie: „Laut einer EU-Studie könnten Konsumenten durch die Abschaffung dieser Lieferbeschränkungen bis zu 14 Milliarden Euro jährlich sparen. Gerade in wirtschaftlich fordernden Zeiten wäre das eine spürbare Entlastung für Millionen Menschen in Europa.“
Auch in der Vergangenheit haben die EU-Behörden gegen Verstöße reagiert. So wurde der Nahrungsmittelmulti Mondelez im Mai 2024 zu einem Bußgeld von 334 Millionen Euro verurteilt, und Anheuser-Busch InBev erhielt 2019 eine Strafe von 200 Millionen Euro.
Der politische Druck wächst
Der politische Druck auf die EU-Kommission steigt. Der Handelsverband und die Gewerkschaft GPA begrüßen die Ankündigung der Kommission, künftig gegen alle TSCs vorzugehen, auch gegen solche, die bisher nicht vom Wettbewerbs- bzw. Kartellrecht erfasst sind. „Es ist ein Gebot der Stunde, endlich für gleiche Einkaufsbedingungen für Händler in allen Mitgliedstaaten zu sorgen und die künstlichen Preisdifferenzen zu reduzieren,“ so Rainer Will.
Ein Blick in die Zukunft: Was erwartet uns?
Die Zukunft des europäischen Einzelhandels hängt von den Entscheidungen der EU-Kommission ab. Ein Verbot der TSCs könnte nicht nur die Preisunterschiede beseitigen, sondern auch die Inflation senken. Die Inflationsrate in Österreich lag im Juni bei 3,3%, deutlich über dem Niveau Deutschlands und der Eurozone.
Barbara Teiber betont: „Viele multinationale Hersteller wollen um jeden Preis an ihren länderspezifischen Preisstrategien festhalten – auf Kosten der Konsumenten. Es ist höchste Zeit, diese Diskriminierung zu verbieten. Das wäre ein wesentlicher Beitrag zur Senkung der hohen Inflation.“
Fazit: Ein notwendiger Schritt zur Fairness
Der Kampf gegen territoriale Lieferbeschränkungen ist ein Kampf für die Fairness im europäischen Binnenmarkt. Die Maßnahmen der EU-Kommission könnten den österreichischen Konsumenten nicht nur finanzielle Erleichterung bringen, sondern auch ein Zeichen setzen gegen die Macht der multinationalen Konzerne.
In einer Zeit, in der die Lebenshaltungskosten für viele Menschen steigen, ist es wichtiger denn je, für faire Wettbewerbsbedingungen zu sorgen und die Preise zu senken. Der „Österreich-Preisaufschlag“ könnte bald der Vergangenheit angehören – ein Schritt, der Millionen von Europäern zugutekommen würde.