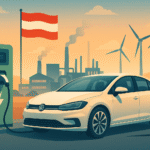Ein alarmierender Weckruf für die Sozialwirtschaft
Am 24. November 2025 wurde ein eindringlicher Appell von den Sozialen Dienstleistern Österreichs (SWÖ) veröffentlicht. In dieser Pressemitteilung wird auf die kritische Lage in der sozialen Infrastruktur hingewiesen, die durch drastische Kürzungen in mehreren Bundesländern verursacht wird. Diese Einsparungen gefährden unmittelbar die Betreuungssicherheit in Frauenberatungsstellen und Opferschutzeinrichtungen, was zu potenziellen Schließungen und einem Verlust von Arbeitsplätzen führen könnte.
Der Kahlschlag in Zahlen
Laut Erich Fenninger, dem Vorsitzenden der SWÖ, erleben wir derzeit einen beispiellosen Kahlschlag in der gesamten Republik. Von Frauenberatungsstellen über psychosoziale Dienste bis hin zu Jugend- und Behinderteneinrichtungen – überall werden Förderungen entweder gestrichen oder nicht verlängert. Bereits zugesagte Finanzierungen werden zurückgezogen, was die soziale Versorgungssicherheit, ein Kernstück der österreichischen Gesellschaft, stark gefährdet.
Einheit als Schlüssel zur Lösung
Die SWÖ betont die Notwendigkeit eines Schulterschlusses innerhalb der Branche. In einer Zeit, in der politische und budgetäre Angriffe die soziale Infrastruktur bedrohen, ist Einigkeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern entscheidend. Yvonne Hochsteiner, Geschäftsführerin der SWÖ, hebt hervor, dass es in dieser angespannten Lage um stabile Arbeitsplätze und die Unterstützung von Menschen in Not geht.
Warum ein Zweijahresabschluss?
Im Zentrum der aktuellen Verhandlungen steht das Angebot der Arbeitgeber von 2,5 %, das über die Jahre 2026 und 2027 verteilt werden soll. Diese Entscheidung wird mit der unsicheren budgetären Situation der Trägerorganisationen begründet. Hochsteiner erklärt, dass die unvorhersehbaren Kürzungswellen, die Bundesländer wie Salzburg, Steiermark, Tirol und Vorarlberg betreffen, die Planungssicherheit massiv beeinträchtigen. Ein Zweijahresabschluss könnte die dringend benötigte Stabilität schaffen.
Die konkreten Auswirkungen auf die Bürger
Die Kürzungen in der sozialen Infrastruktur haben weitreichende Auswirkungen auf die Bürger. Einrichtungen, die essentielle Dienste für Frauen, Jugendliche und Menschen mit Behinderungen bieten, sehen sich mit existenziellen Bedrohungen konfrontiert. Wenn diese Dienste eingeschränkt oder geschlossen werden, verlieren viele Menschen den Zugang zu dringend benötigter Unterstützung.
Expertenmeinungen zur Krise
- Dr. Anna Müller, Sozialwissenschaftlerin: „Die derzeitigen Kürzungen sind nicht nur ein finanzielles Problem, sondern stellen eine ernsthafte Gefahr für den sozialen Zusammenhalt dar. Wenn wir nicht handeln, könnten die langfristigen Folgen verheerend sein.“
- Mag. Karl Huber, Wirtschaftswissenschaftler: „Ein Zweijahresabschluss könnte die notwendige Stabilität bieten, jedoch müssen wir sicherstellen, dass die Mittel effizient und zielgerichtet eingesetzt werden.“
Ein Blick in die Zukunft
Die SWÖ betont, dass die Verhandlungen nicht nur um finanzielle Aspekte gehen, sondern um die Sicherstellung der sozialen Versorgung. Ein stabiler Abschluss über zwei Jahre könnte die Berechenbarkeit für Träger, Beschäftigte und letztlich für die Menschen, die auf soziale Unterstützung angewiesen sind, gewährleisten.
Politische Verantwortung und Abhängigkeiten
Hochsteiner appelliert an die Politik, ihren Teil zur Lösung der Krise beizutragen. Die Bundesländer sind in der Pflicht, die soziale Infrastruktur nicht weiter zu zerstören, während der Bund sicherstellen muss, dass zweckgewidmete Mittel tatsächlich dort ankommen, wo sie gebraucht werden.
Die dritte Verhandlungsrunde: Ein entscheidender Moment
Die SWÖ geht mit dem klaren Ziel in die dritte Verhandlungsrunde, die Versorgungssicherheit zu stabilisieren und Arbeitsplätze zu sichern. Ein gemeinsamer Weg mit den Arbeitnehmervertretern ist entscheidend, um das Sozialsystem gegen die aktuellen Angriffe zu verteidigen.
Fazit: Ein Aufruf zur Einigkeit und Stabilität
In einer abschließenden Bemerkung betont Hochsteiner die Notwendigkeit von Einigkeit und Stabilität. Die Politik muss erkennen, dass der Sozialstaat keine Verfügungsmasse ist, sondern das Fundament der österreichischen Gesellschaft. Die kommenden Verhandlungen werden zeigen, ob die Branche in der Lage ist, die Herausforderungen zu meistern und einen Weg zur Stabilität zu finden.