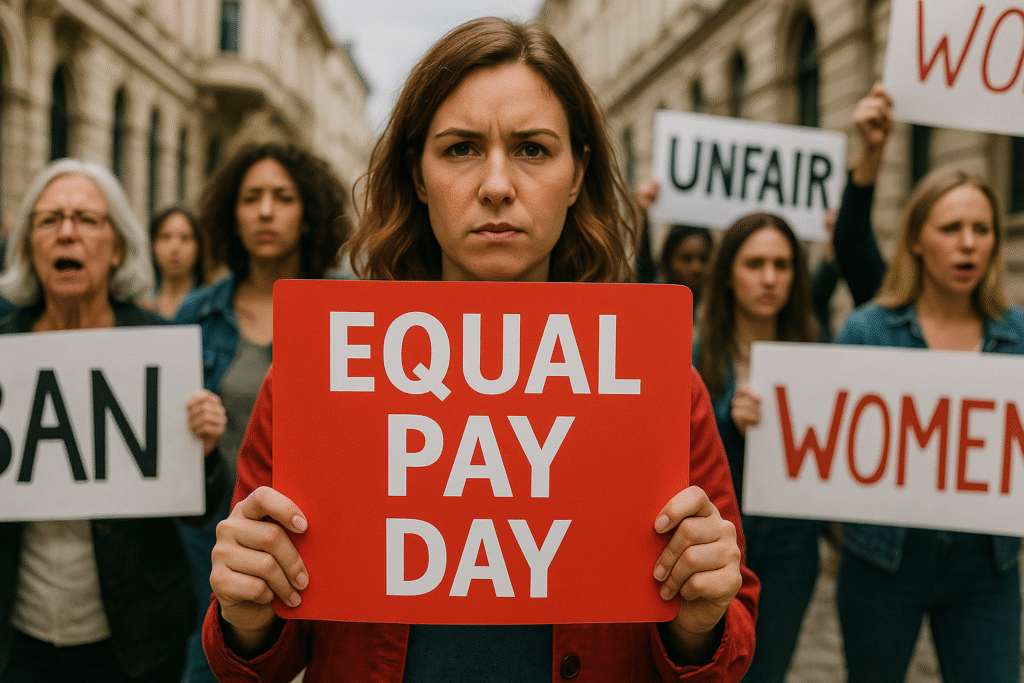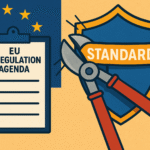Ein Blick auf die schockierende Realität: Der Equal Pay Day in Wien
Am 22. November 2025 wird in Wien der Equal Pay Day begangen. Ein Datum, das keine Feierlichkeit, sondern ein Mahnmal für die andauernde Ungleichheit zwischen den Geschlechtern ist. Trotz aller Fortschritte klafft in Österreich immer noch eine erhebliche Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Während Wien mit einer Lohnlücke von 11 Prozent im Vergleich zum österreichweiten Durchschnitt von 18,3 Prozent besser dasteht, bleibt die Ungleichheit erschreckend sichtbar.
Historischer Hintergrund: Ein langer Kampf für Gleichstellung
Die Geschichte der Einkommensgleichheit ist eine des langen Kampfes. Bereits in den 1960er Jahren begannen Frauen, sich für gleiche Bezahlung einzusetzen, nachdem sie jahrzehntelang in der Arbeitswelt benachteiligt worden waren. Die Einführung des Gleichbehandlungsgesetzes 1979 war ein Meilenstein, doch die Realität hat sich langsamer verändert als die Gesetzestexte.
In den 1990er Jahren wurde die Diskussion über die Lohnlücke intensiver, und der Equal Pay Day wurde weltweit zu einem Symbol für die fortwährende Ungerechtigkeit. Dieser Tag markiert den Zeitpunkt im Jahr, bis zu dem Frauen im Vergleich zu Männern unbezahlt arbeiten, wenn man die Lohnunterschiede berücksichtigt.
Wien als Vorreiter: Warum die Hauptstadt besser abschneidet
Wien gilt als Vorreiter in Sachen Gleichstellung. Durch eine konsequente sozialdemokratische Politik, die auf den Ausbau öffentlicher Dienste setzt, konnte die Lohnlücke auf 11 Prozent reduziert werden. Erich Kniezanrek, Bundesgeschäftsführer der FSG-younion, betont: „Dass Wien Jahr für Jahr der Ort ist, an dem die Lohnschere am spätesten zuschnappt, ist kein Zufall. Es ist das Resultat einer Politik, die versteht, dass gute öffentliche Dienste Voraussetzung für echte Gleichstellung sind.“
- Kinderbetreuung: Ganztägige und leistbare Kinderbetreuungsangebote sind entscheidend, um Frauen den Einstieg und Verbleib im Arbeitsmarkt zu ermöglichen.
- Pflege: Öffentliche Pflegeangebote entlasten Frauen, die häufig die Hauptverantwortung für die Pflege von Angehörigen tragen.
- Bildung: Der Zugang zu Bildung und Fortbildung ist in Wien breit gefächert und unterstützt Frauen bei der beruflichen Weiterentwicklung.
Vergleich mit anderen Bundesländern: Wo steht Österreich?
Während Wien mit seiner progressiven Politik eine Vorreiterrolle einnimmt, sieht die Situation in anderen Bundesländern weniger rosig aus. In ländlichen Regionen, wo traditionelle Rollenbilder oft noch stärker verankert sind und öffentliche Dienste weniger ausgebaut sind, ist die Lohnlücke häufig größer.
Ein Blick auf Oberösterreich und die Steiermark zeigt, dass hier die Lohnlücke oft über 20 Prozent liegt. Dies ist nicht nur auf strukturelle Unterschiede zurückzuführen, sondern auch auf die geringere Verfügbarkeit von Kinderbetreuungsplätzen und die stärkere Verbreitung traditioneller Familienmodelle.
Die Auswirkungen auf die Bürger: Mehr als nur Zahlen
Die Lohnungleichheit hat weitreichende Auswirkungen auf das Leben der Bürger. Frauen verdienen nicht nur weniger, sondern haben auch geringere Rentenansprüche, was zu Altersarmut führen kann. Zudem sind Frauen häufiger in Teilzeit beschäftigt, was ihre Karrierechancen und ihr Einkommen weiter schmälert.
Ein fiktives Beispiel: Anna, eine 35-jährige Mutter aus Wien, arbeitet in Teilzeit, um sich um ihre beiden Kinder zu kümmern. Obwohl sie qualifiziert und erfahren ist, verdient sie deutlich weniger als ihre männlichen Kollegen. „Es ist frustrierend zu wissen, dass mein Gehalt nicht nur meine jetzige Lebensqualität beeinflusst, sondern auch meine Zukunft. Ich mache mir Sorgen, ob ich im Alter über die Runden kommen werde“, erzählt sie.
Expertenmeinungen: Was muss sich ändern?
Experten sind sich einig: Ohne gezielte Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge wird die Lohnlücke nicht geschlossen werden. „Öffentliche Dienste sind kein Kostenfaktor, sondern das Fundament sozialer Gerechtigkeit. Wer die Daseinsvorsorge schwächt, schwächt Frauen. Das lassen wir nicht zu“, erklärt Kniezanrek.
Darüber hinaus fordern Fachleute eine stärkere Sensibilisierung für das Thema Gleichstellung in Unternehmen. „Es geht darum, Bewusstsein zu schaffen und Unternehmen zu motivieren, gleiche Bezahlung als Standard zu etablieren“, sagt Maria Huber, Gender-Expertin der Universität Wien.
Zukunftsausblick: Ein langer Weg zur Gleichstellung
Der Weg zur vollständigen Gleichstellung ist noch lang. Doch es gibt Hoffnung: Immer mehr junge Menschen fordern gleiche Rechte und Chancen, und das Thema Gender Pay Gap ist stärker als je zuvor im öffentlichen Diskurs verankert.
Politische Maßnahmen wie das Gleichbehandlungsgesetz und Initiativen zur Förderung von Frauen in Führungspositionen zeigen Wirkung. Zudem setzen immer mehr Unternehmen auf Transparenz bei Gehältern, um Diskriminierung vorzubeugen.
Die FSG-younion fordert weiterhin flächendeckend starke öffentliche Angebote, nicht nur in Wien, sondern in allen Bundesländern. Denn nur so kann eine gerechte Gesellschaft entstehen, in der der Equal Pay Day eines Tages überflüssig wird.
Bis dahin bleibt der 22. November ein wichtiges Datum, das uns daran erinnert, dass der Kampf für Gleichstellung noch nicht vorbei ist. Und dass wir alle gefordert sind, unseren Teil dazu beizutragen.